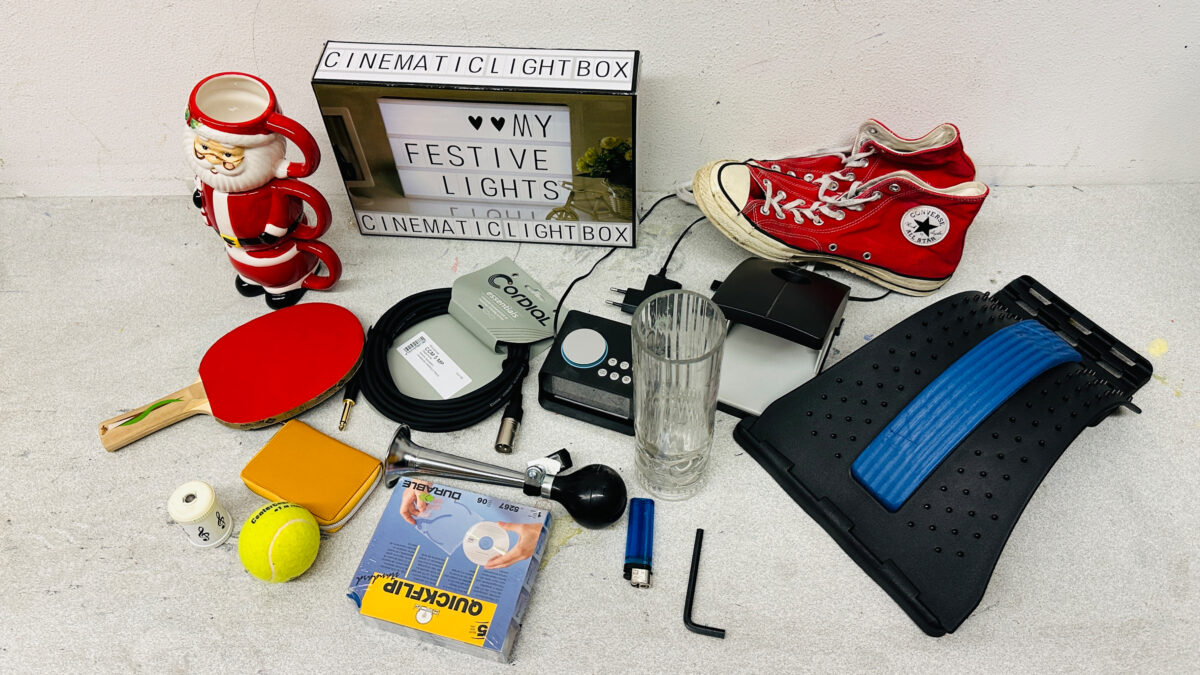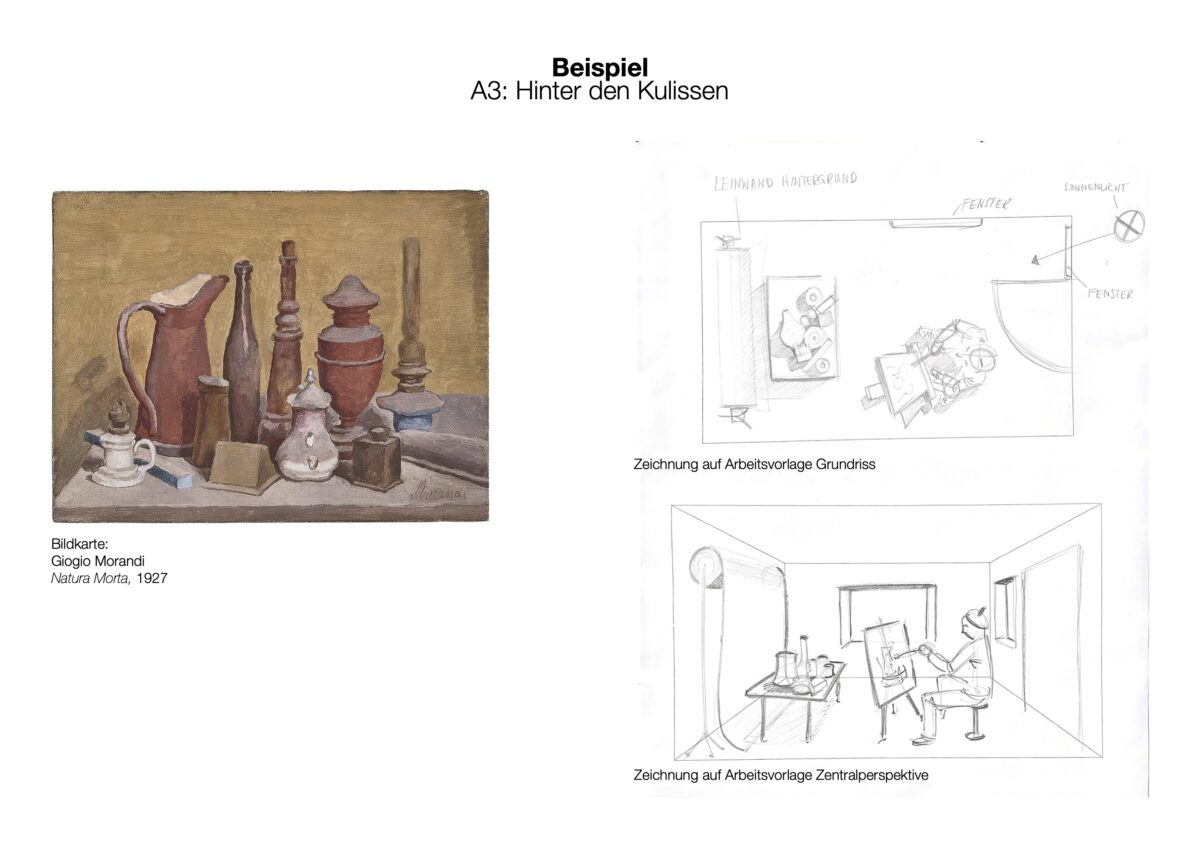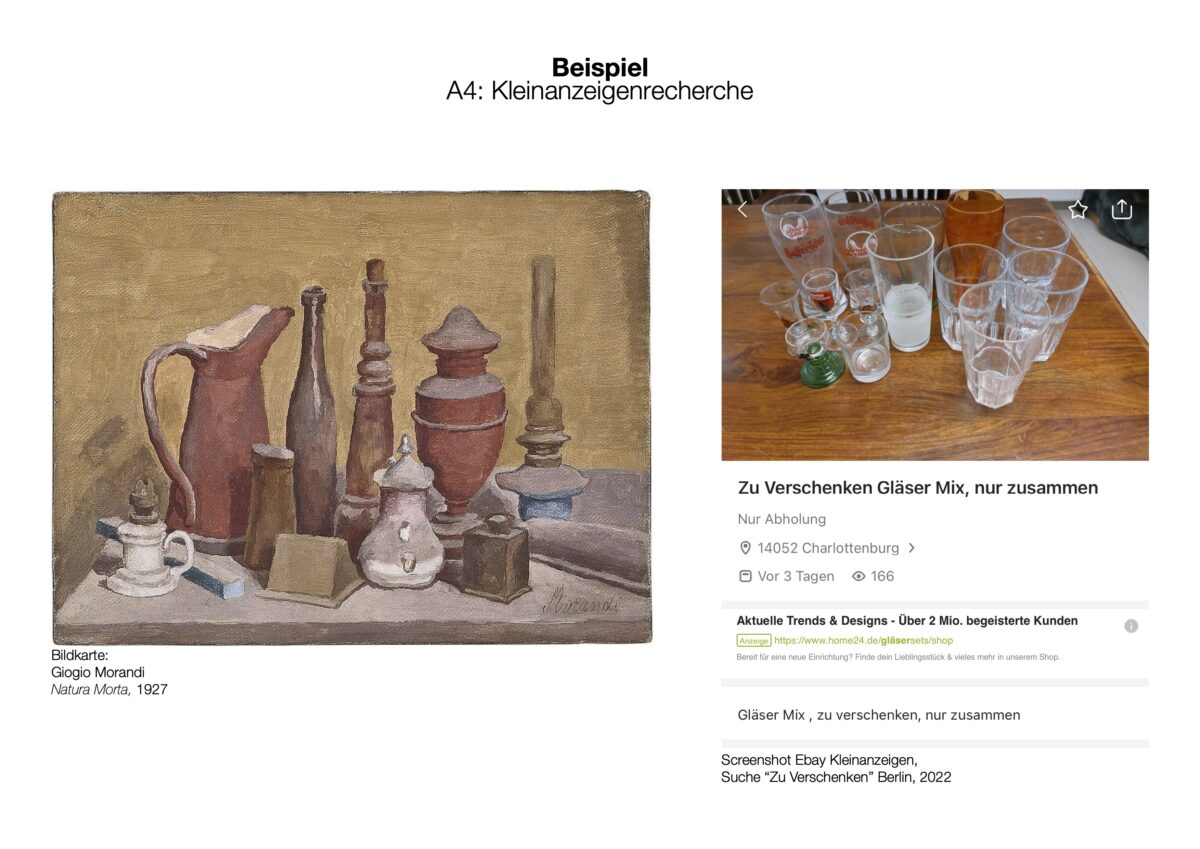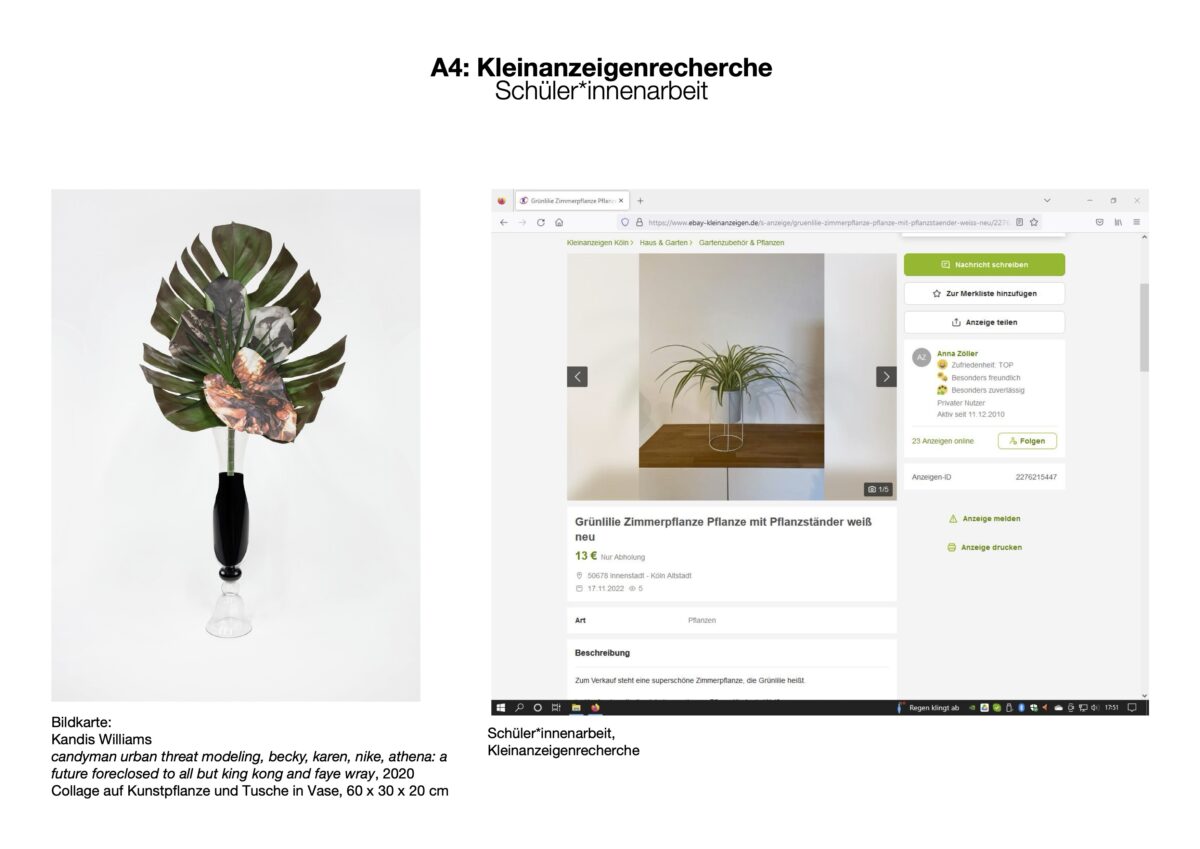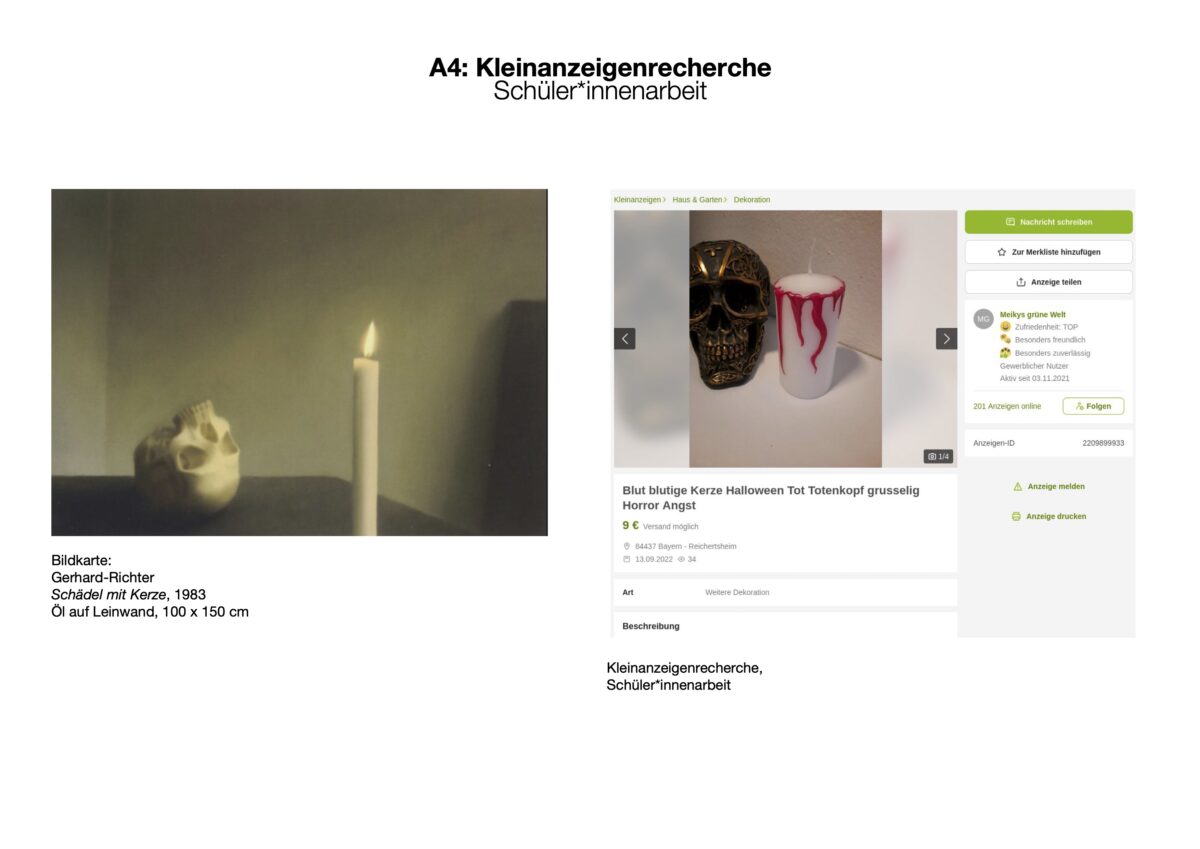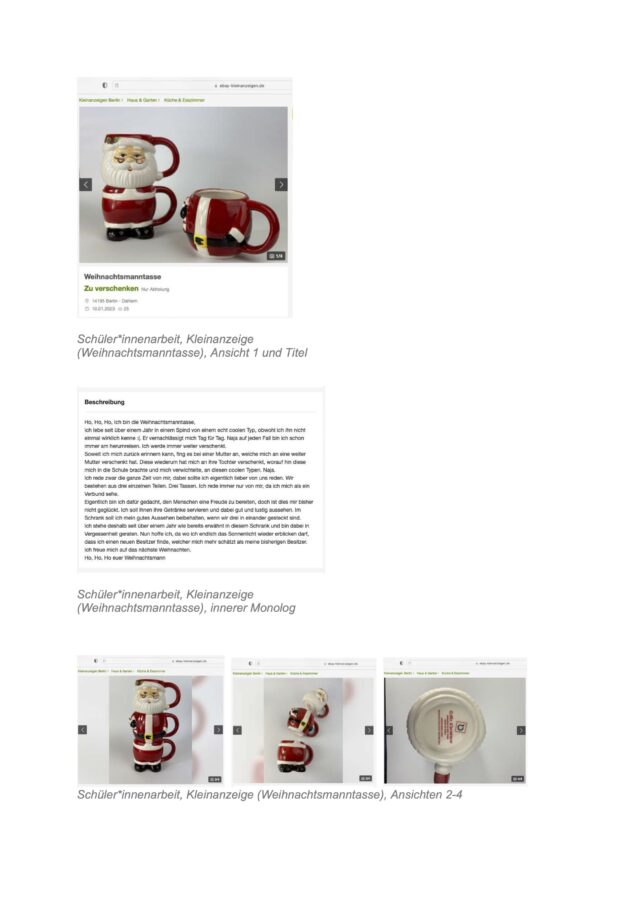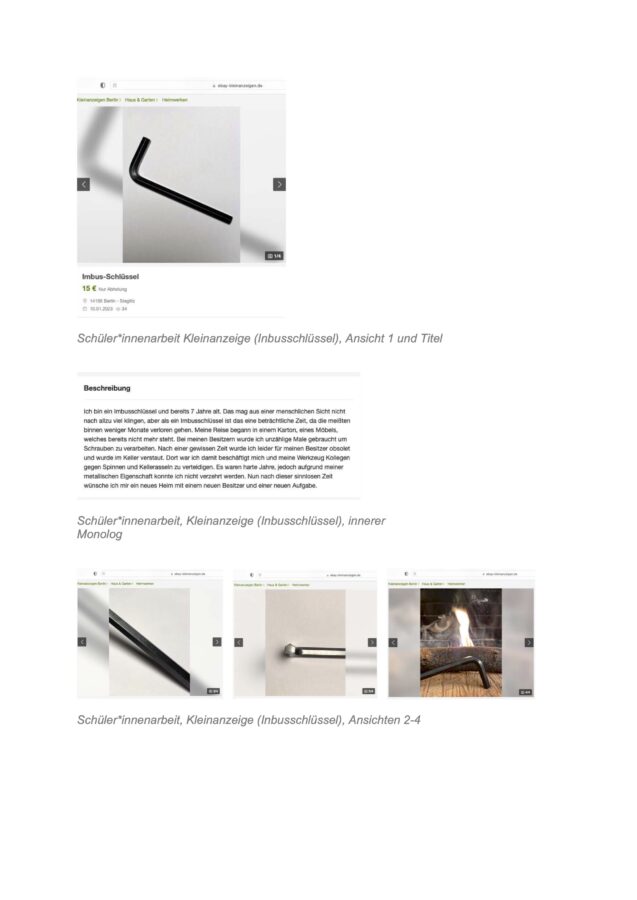myow – Workbook Arts Education
About myow
Das Workbook Arts Education ist eine partizipative Plattform, auf der neue Konzepte und innovative Ideen für den Kunstunterricht und die Kulturelle Medienbildung im Horizont fortschreitender Digitalisierung publiziert werden. Die Beiträge des Workbooks sind nach Kategorien, Themen, Zielgruppen und Tools systematisiert und frei verfügbar. Alle Beiträge sind aus der Praxis für die Praxis entwickelt worden, um diese konsequent weiterzudenken und stetig durch aktuelle Bezüge zu erweitern.
MISSION STATEMENT
Jedes Foto, jeder Gedanke, jedes Gespräch ist heute automatisch informiert durch die Möglichkeiten und den Einfluss des Internets. Für das Workbook Arts Education sollen unter dieser Prämisse Ideen für Kunstpädagogik und Kulturelle Medienbildung im Internet State of Mind (Carson Chan) entwickelt werden, um Schule und andere Institutionen der kulturellen Bildung vor dem Hintergrund lernender Algorithmen, Whistleblowing, Hacktivism, Softwarearchitekturen, Crowdsourcing, Digital Commons… konsequent weiter zu gestalten.
Prototyping Futures
In Designprozessen werden Prototypen und Modelle entworfen, um neue Ideen auszutesten und weiterzuentwickeln. Mit dem Workbook Arts Education soll dieser Prozess auf komplexe Prozesse und Fragestellungen in den Kunstunterricht und auf die Kulturelle Bildung übertragen werden. Hier entstehen Beiträge, die produktiv mit neuen Möglichkeiten von Smartphone, Internet und Co umgehen und Zukünfte probehalber formulieren. Let’s Proto!
Collaborate
Neues zu denken und in Schulen zu implementieren geht leichter in gemeinsamer Anstrengung. Wie können interessierte Kolleg*innen an dem Prozess beteiligt werden?
Hack It
Wie lassen sich neue Formate und neue Fragestellungen an den bestehenden Lehrplan oder die institutionellen Rahmenbedingungen andocken? Welche aktuellen Themen oder Methoden finden bisher noch keinen Platz?
Test It
Jeder Beitrag sollte vor der Veröffentlichung mindestens einmal mit Kindern bzw. Jugendlichen in der Praxis getestet werden.
Adjust It
Was hat beim ersten Testlauf nicht funktioniert, was ließe sich noch verbessern? Wie sieht das Feedback der Schüler*innen dazu aus? Dieses sollte in die finale Version des Beitrags einfließen.
Share It
Wie sieht Ihr Prototyp des zukünftigen Kunstunterrichts aus? Lassen Sie andere davon wissen und teilen Sie Ihren Beitrag. MYOW – Make Your Own Workbook!
POST-INTERNET ARTS EDUCATION
Das Projekt MYOW – Make Your Own Workbook wurde 2016 durch Torsten Meyer, Kristin Klein, Gila Kolb und Konstanze Schütze am Institut für Kunst & Kunsttheorie der Universität zu Köln initiiert und ist Teil des gemeinsamen Forschungsschwerpunktes Post-Internet Arts Education. Es nimmt die stark gewandelten Bedingungen für kunstpädagogische Praxis und kulturelle Medienbildung im Internet State of Mind (Carson Chan) in den Blick und setzt sich zum Ziel, Konsequenzen für Bildung in Auseinandersetzung mit Künsten und Medien im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert zu entwickeln. Das Workbook versammelt in der Praxis entwickelte und umgesetzte Beiträge zu aktuellen Themen vor dem Hintergrund weltweit vernetzter Communities und global zirkulierender Bildwelten und verknüpft dabei Forschung, schulische und außerschulische Praxis miteinander.
HERAUSGEBER*INNEN
Kristin Klein
Universität zu Köln
Gila Kolb
PH Schwyz Goldau
Torsten Meyer
Universität zu Köln
Konstanze Schütze
PH Karlsruhe
IMPRINT
© 2017 myow.org
Make Your Own Workbook // Workbook Arts Education
Institut für Kunst & Kunsttheorie, Prof. Dr. Torsten Meyer
Anbieterkennzeichnung im Sinne des § 5 TMG:
Der unter myow.org abrufbare Telemediendienst ist ein Angebot der Universität zu Köln, Institut für Kunst & Kunsttheorie,
Gronewaldstr. 2, D-50931 Köln
http://kunst.uni-koeln.de
Verantwortlich: Prof. Dr. Torsten Meyer
t.meyer(at)uni-koeln.de